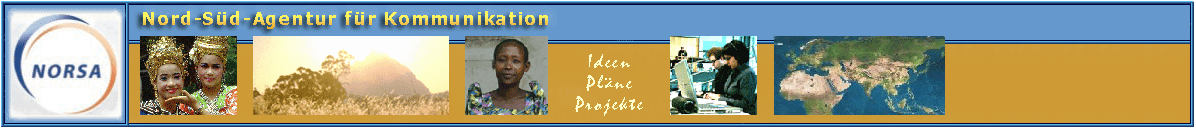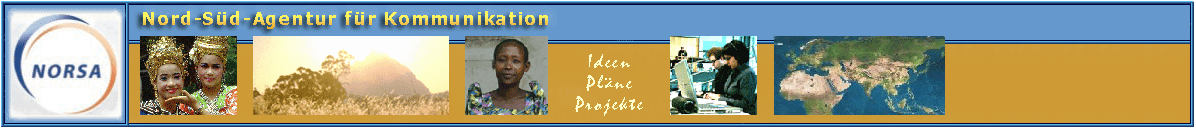|
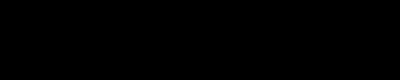 Gemeinsam, die digitale Zeitschrift für den christlich-islamischen Dialog, können Sie als PDF-Dokument bestellen bei info@norsa.net. Gemeinsam, die digitale Zeitschrift für den christlich-islamischen Dialog, können Sie als PDF-Dokument bestellen bei info@norsa.net.
Ausgabe Nr. 5 - Oktober 2006
Ein Dokument praktischen Engagements
Von Prof. Udo Steinbach
„Ein neuer Dialog des Handelns“ heißt Erhard Brunns soeben erschienenes Buch. Es ist ein Aufruf gegen das Gähnen, das so manchen befällt, der vom „Dialog der Kulturen“ hört. Das Missverhältnis von Dialogritualen und der Folgenlosigkeit dieses Tuns lässt Dialog schal erscheinen.
„Etwas tun“ und sich selbst tatkräftig einbringen – das ist der Aufruf dieses Buches. Der Autor hat es selbst über 15 Jahre vorgelebt: In Ostafrika und im Sahel, wo Christen und Muslime vor allem ein Problem gemeinsam haben: Armut und Krankheit. Aber auch in Deutschland, wo sich – wie jüngste Ereignisse gezeigt haben – Gewaltpotenziale gerade unter sozial Schwachen aufladen. Den beiden Weltreligionen, deren Anhänger in vielen Teilen der Welt eng neben- und miteinander leben, fällt eine besondere Verantwortung zu. Sie artikuliert sich in der Sprache des Handelns. Deshalb ist Brunns Buch ein Dokument praktischen Engagements.
Christliche und muslimische Geistliche und andere Persönlichkeiten in Afrika berichten über Erfahrungen des Helfens in ihren eigenen, aber auch in Gemeinden des anderen Glaubens. Brunns Anliegen ist legitim: Wie kann man unter den Wohlhabenden unter den Muslimen – und deren gibt es bekanntlich viele – ein Bewusstsein für die Verantwortung bei der Überwindung von Armut und Krankheit – nicht zuletzt Aids – schaffen? Hier hat sich das Christentum mit seinen katholischen und evangelischen Organisationen seit langem engagiert. In diesem Zusammenhang hat die Initiative des Autors, in die Armutsbekämpfung z.B. in Uganda die türkisch-deutsche Organisation Milli Görüş (die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird) einzubinden, einen besonderen Charme – schließlich leben viele ihrer Mitglieder in Deutschland oberhalb des Einkommensdurchschnitts in vielen Teilen Afrikas.
Erfolgreiche Ansätze im praktischen Dialog
Diese den Leser vielleicht ein wenig bizarr anmutende Episode lässt eines der Anliegen des Buches erkennen: Es soll neue und bereits ansatzweise erfolgreiche Ansätze vor allem deutscher Organisationen im praktischen Dialog hervorheben; es soll zugleich weitere Gespräche und Formen der Zusammenarbeit über die Grenzen der Religionen hinweg anregen. Die Milli-Görüş-Episode aber macht zugleich deutlich, dass der „Dialog des Handelns“ eine sehr persönliche, ja emotionale Sicht der Verhältnisse zwischen Christen und Muslimen bietet. Dass sein Urteil, durch langjährige Freundschaften mit einigen der portraitierten muslimischen Persönlichkeiten beeinflusst ist, nimmt der Autor in Kauf, um ein Gegengewicht zu der seiner Meinung nach bisher oft einseitig zu kritischen Beurteilung zu setzen. In diesem Sinne erfolgte die Auswahl der Beobachtungen zum türkischen Ministerpräsidenten Recep Erdoğan mit der dezidierten Perspektive, das Positive zu betonen.
Dieser positive Duktus, der die Grundorientierung des Buches bestimmt, kennzeichnet auch die auf Deutschland bezogenen Kapitel des Buches. Das lässt sich aus der Darstellung bestimmter muslimischer Kräfte und Persönlichkeiten ablesen, die in unserem Land von vielen mit Misstrauen beobachtet werden. Die Reformkräfte in deren Reihen zu fordern, dabei stärker (national wie international) in die Pflicht zu nehmen, aber auch intensiver in die öffentlichen politischen Diskurse unseres Landes einzubeziehen, ist ein Hauptanliegen des Buches. Dass dies auch aufgrund der inneren Dynamik dieser Organisationen nicht leicht ist, deutet der Autor aus persönlicher Erfahrung in seinem Buch mehrfach an.
Intuitiver spiritueller, persönlicher Weg
Auf seinem intuitiven, spirituellen, persönlichen Weg, neue Dialogmöglichkeiten zu erkunden, sind Fehleinschätzungen, Niederlagen und Enttäuschungen Teil des beschrittenen Weges. Der Autor verschweigt sie nicht. Oft bewegte er sich in einem Umfeld, das er – wie er selbst sagt – nur ansatzweise kannte.
Erhard Brunn wollte seine Erfahrungen nicht aus wissenschaftlicher Distanz präsentieren; es ist kein akademisches Buch. Und das tut der Wirkung gut. Gerade die Nähe des Autors zu den Akteuren des Buches sollte die Leser zu kritischer Auseinandersetzung mit dem Buch einladen. Die Hinterfragung vieler Schilderungen und Deutungen ist erwünscht.Und sie ist notwendig, um gemeinsam weiterzukommen zu einem Zusammenleben, zu dem es weltweit keine Alternative gibt. Um auch weiterzukommen auf dem Weg vieler Migranten aus der islamisch geprägten Welt hinein in die offene deutsche Gesellschaft, die zusehends eine europäische wird. Dies ist ein schwieriger und widersprüchlicher Prozess. So mag es auch dem Leser dieses Buches erscheinen. Natürlich gäbe manche Textstelle andere Deutungsmöglichkeiten als die des Autors her.
Ich habe die Initiativen des Autors über mehrere Jahre verfolgt und sein Anliegen mit Zuspruch begleitet. Sein Buch ist lebendiger Ausdruck dieses Anliegens. Ich empfehle es zur Lektüre mit der Einladung, sich positiv, wo nötig auch kritisch mit ihm auseinanderzusetzen.
|